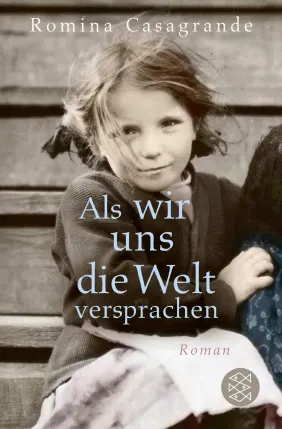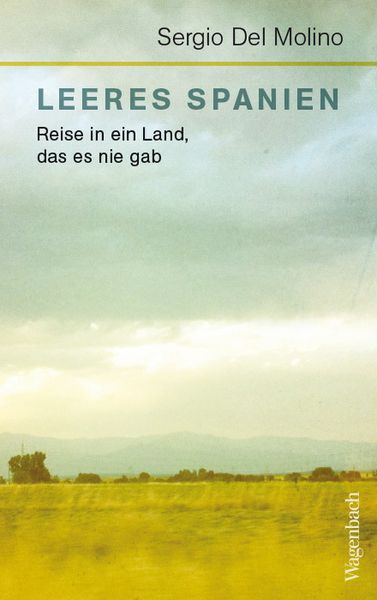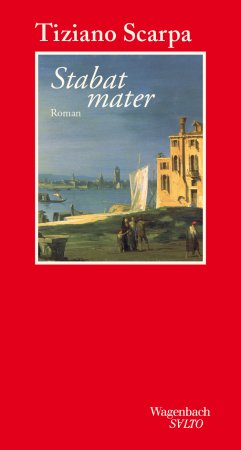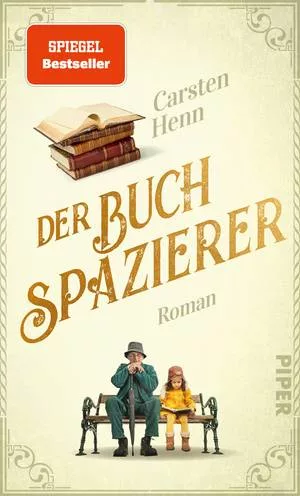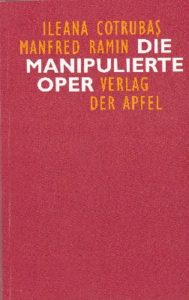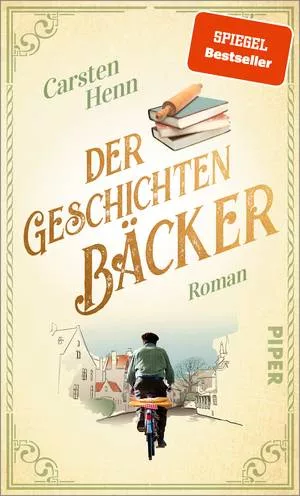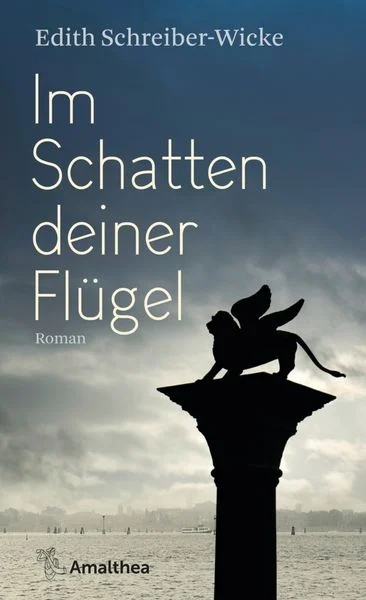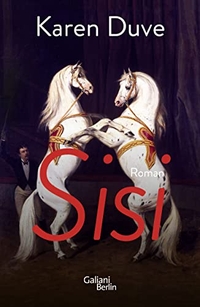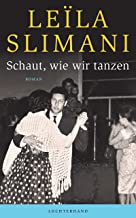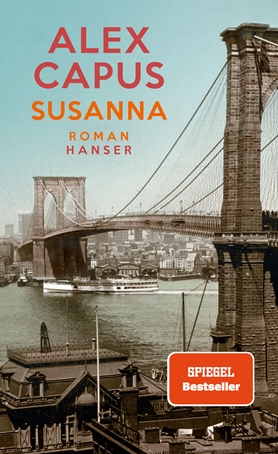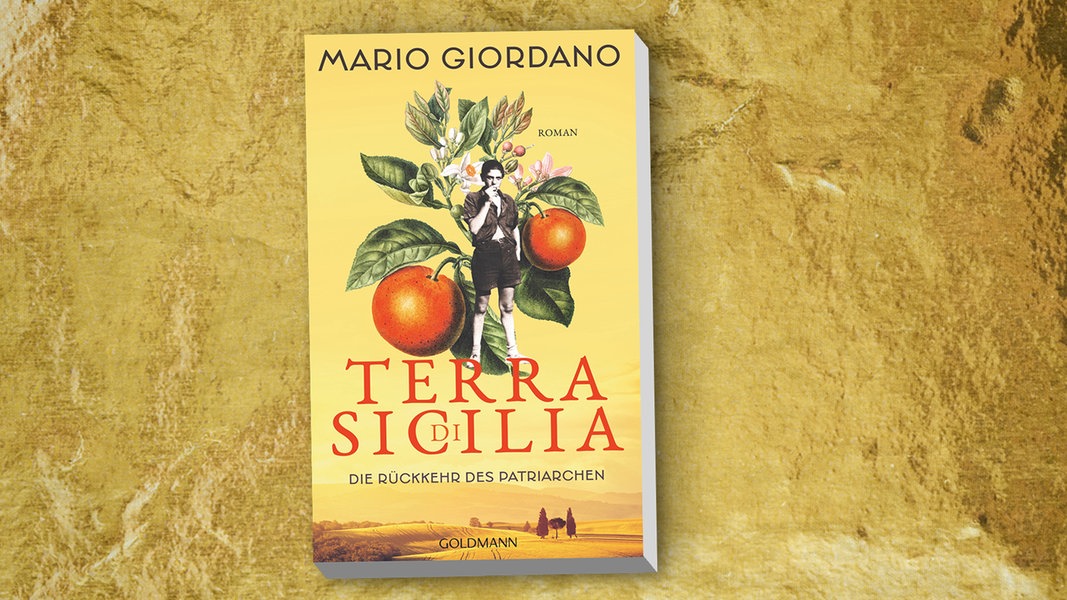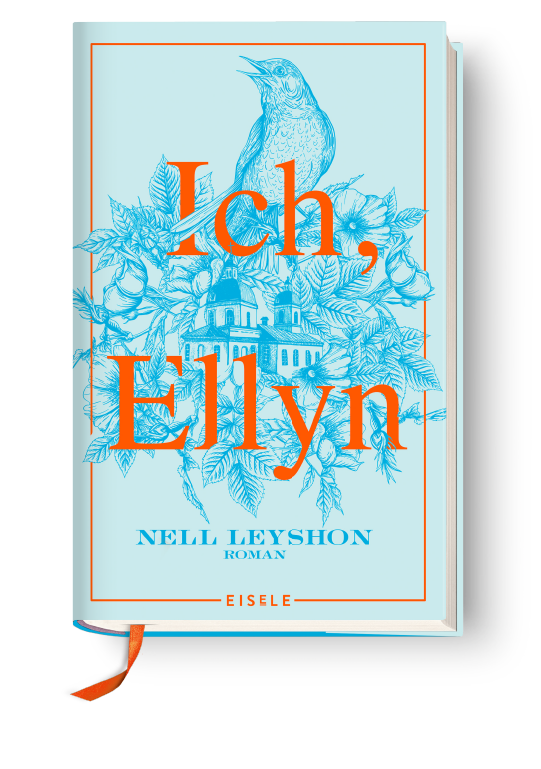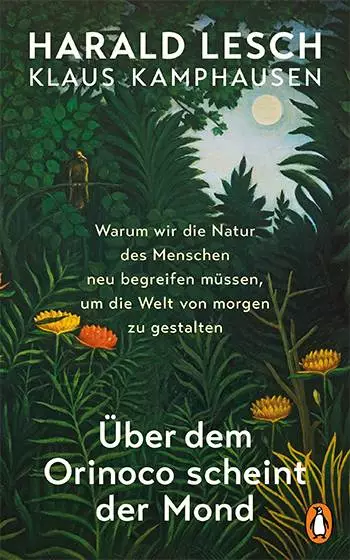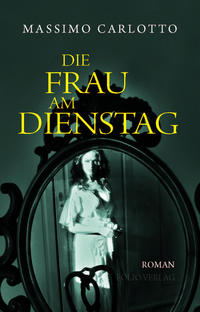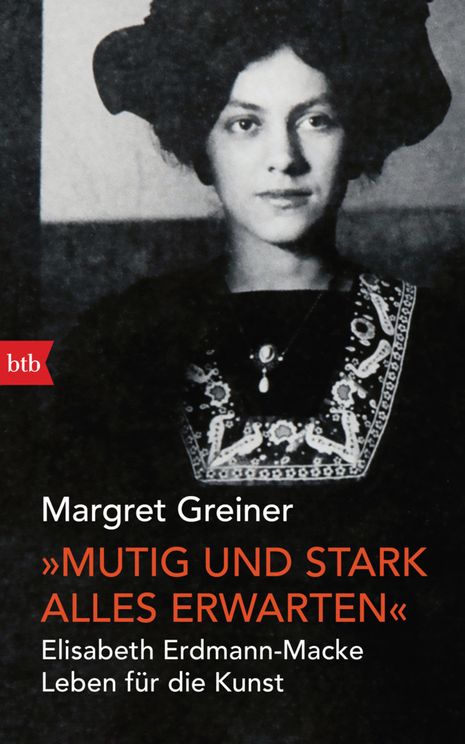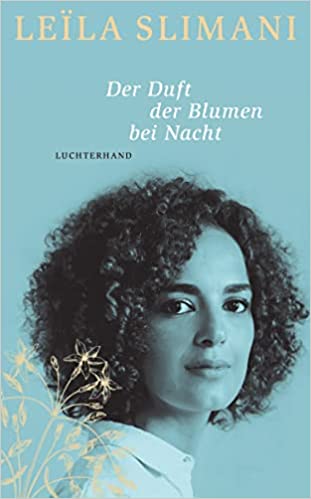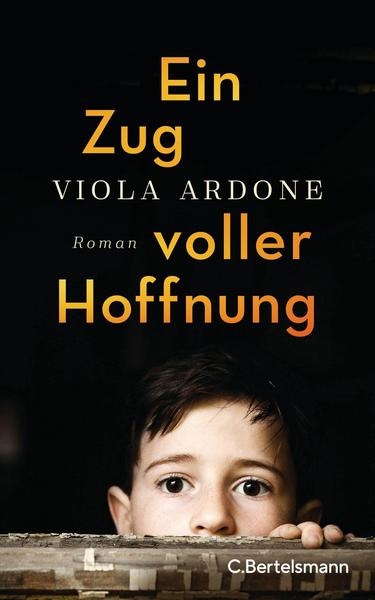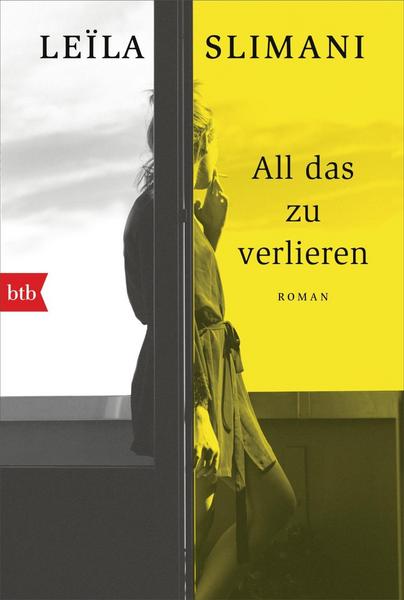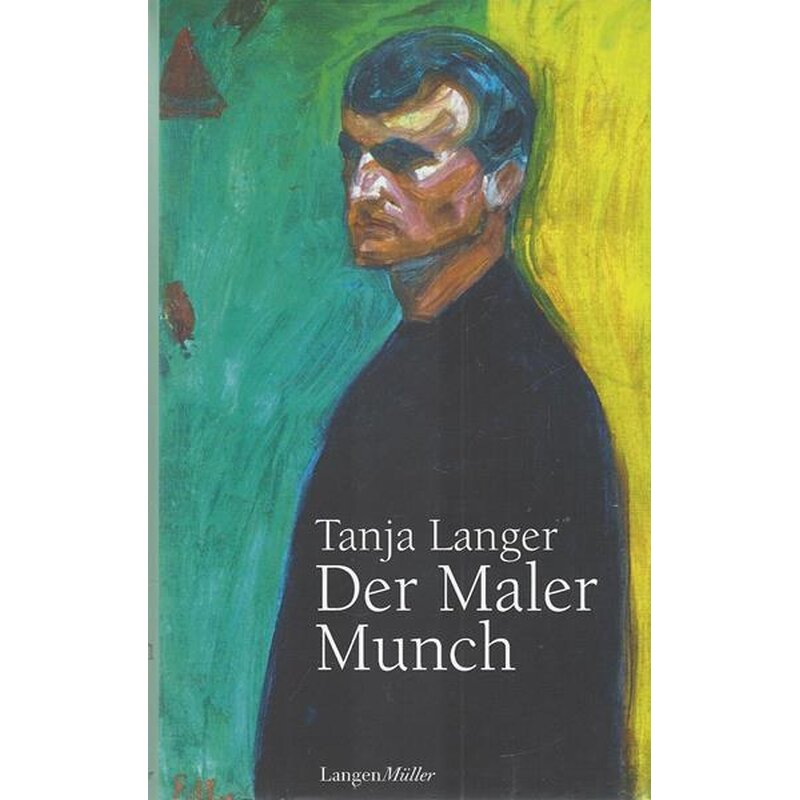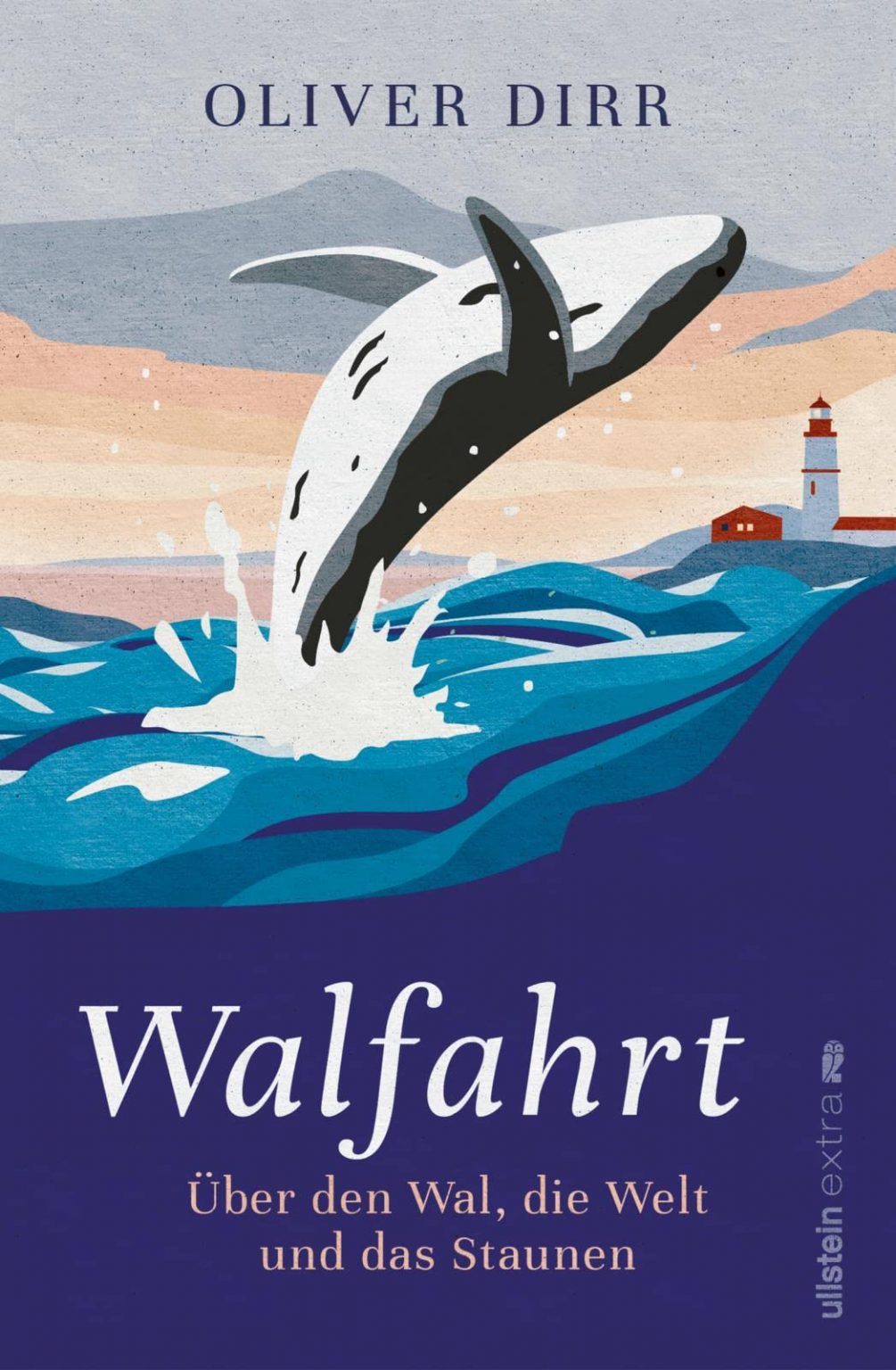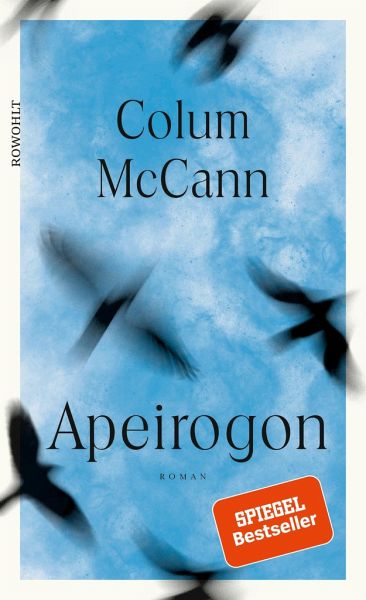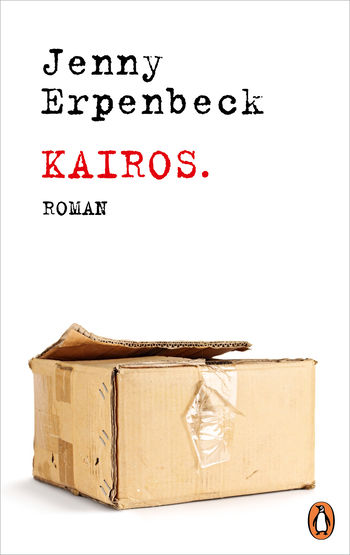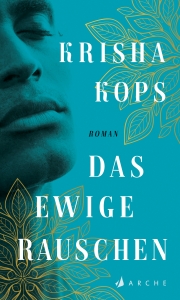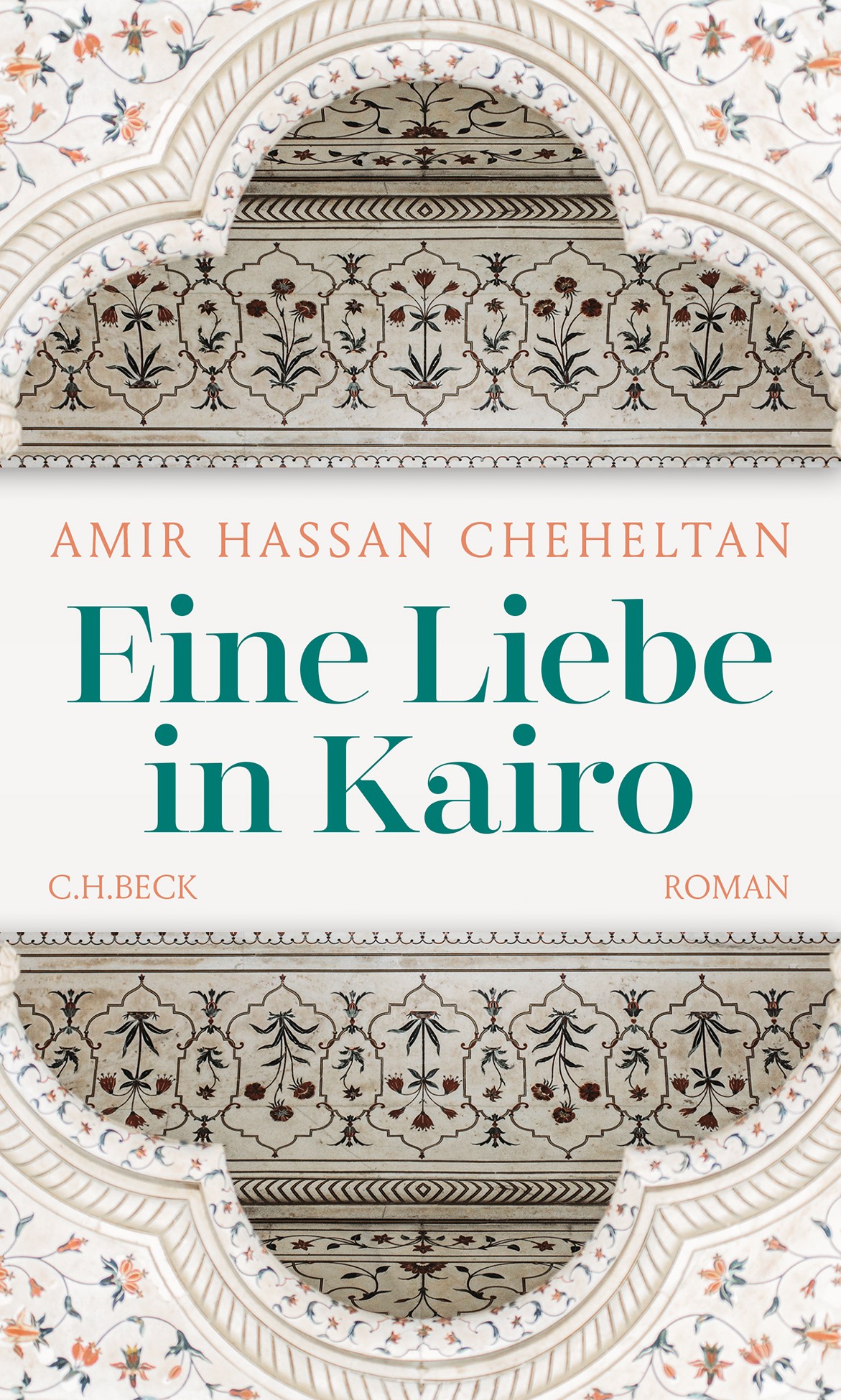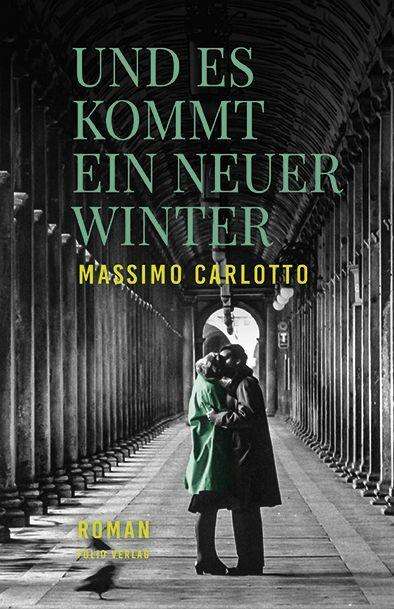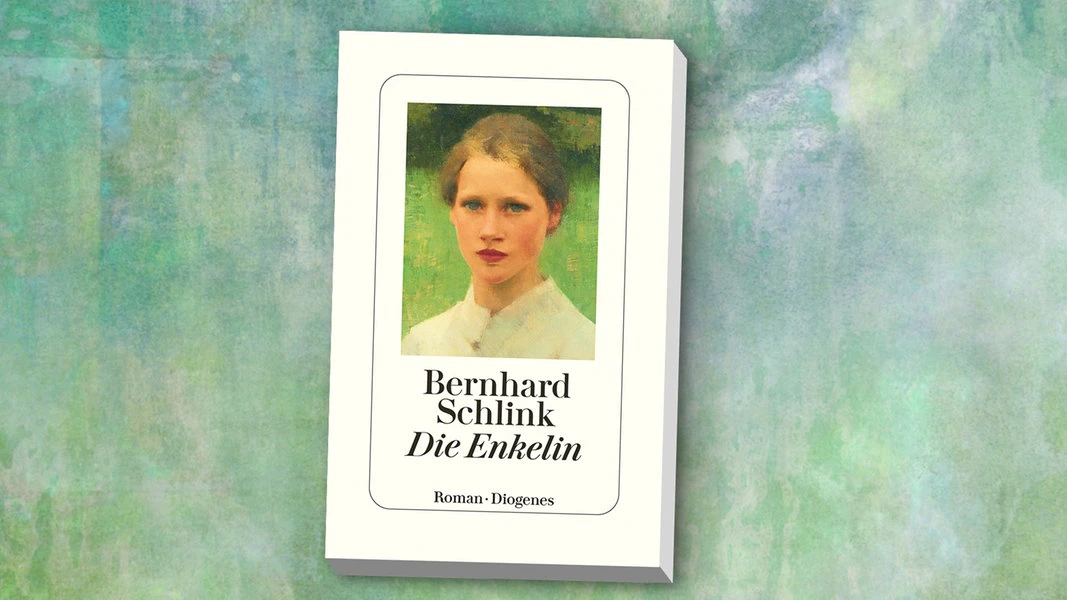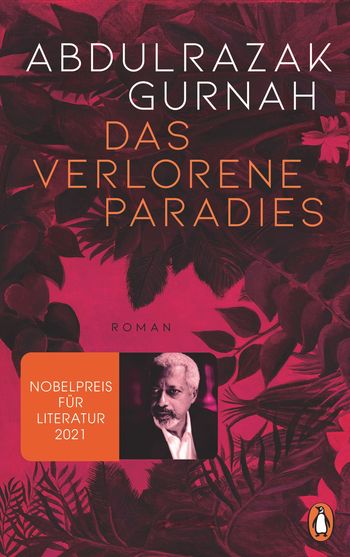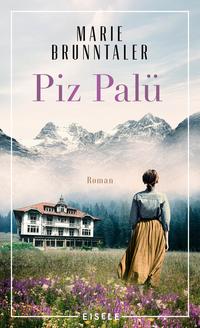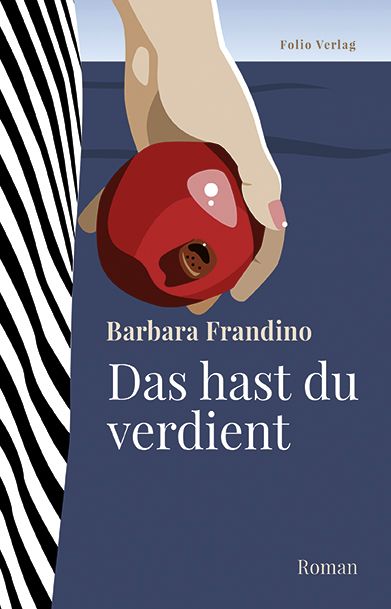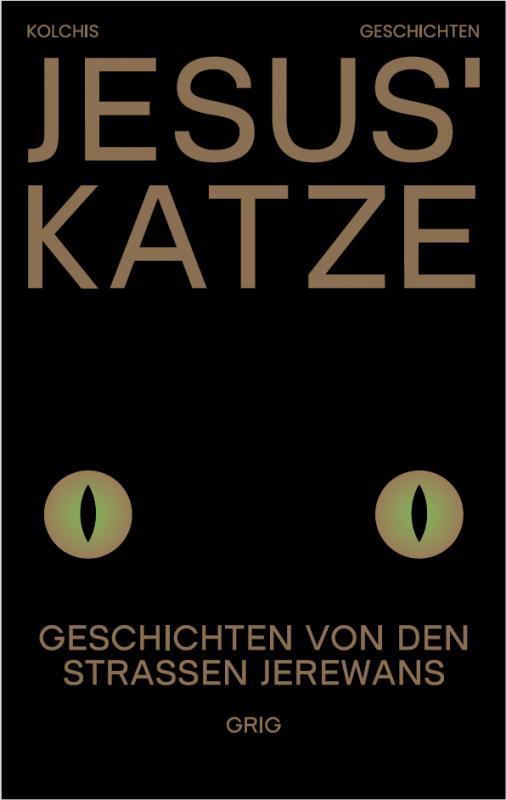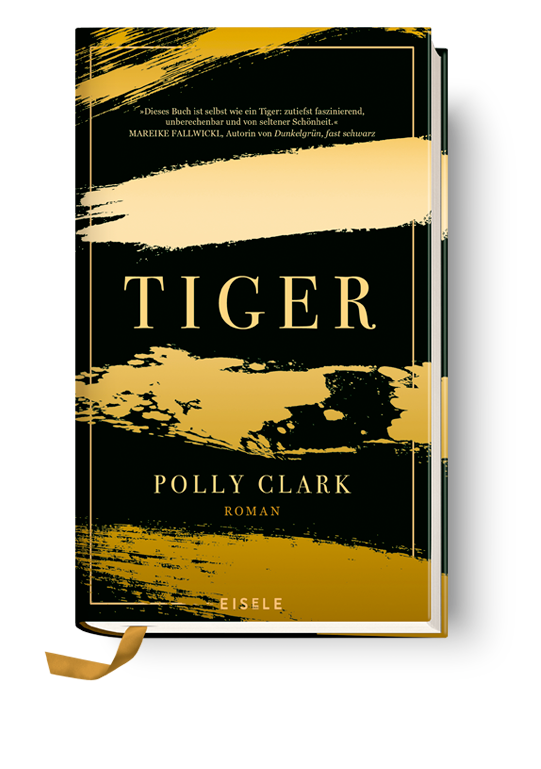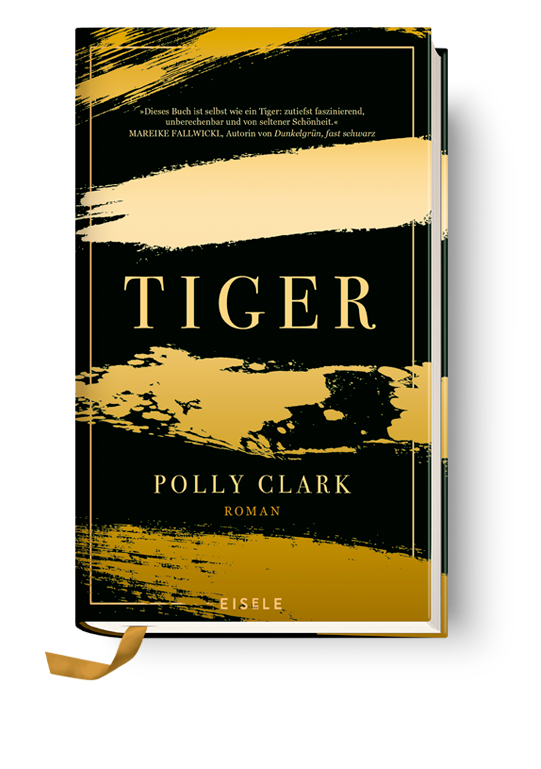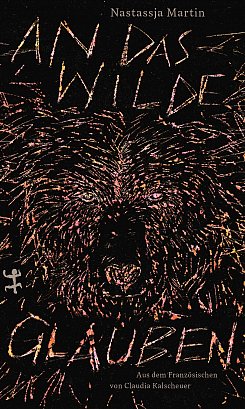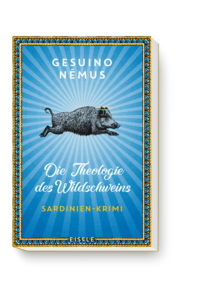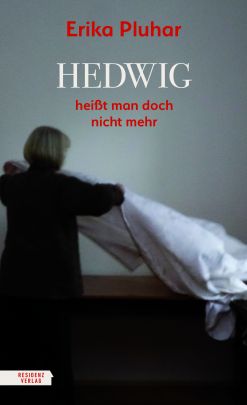Aus dem Englischen von Ursula C. Sturm
„Der Wald argumentiert nicht. Der Wald lügt nicht. Der Wald fordert von dir nichts weiter als Respekt. Und der Herrscher über den Wald, der Zar, ist der TIGER.“
Dieses, dem Roman vorangestellte Zitat, umfasst das Thema: Respekt vor der wilden, ungezähmten Natur!
Die Autorin nennt ihr Buch einen Roman. Aber eher sollte es heißen: Vier Erzählungen um das geheimnisvolle Wesen „Tiger“.
Es beginnt mit einem Prolog. Wie viele Männer in der russischen Taiga träumt auch Dimitri davon, einen Tiger zu erlegen und durch den Verkauf des Tieres immens reich zu werden. Doch es kommt anders: Der König des Waldes stürzte sich lautlos auf ihn, schlug seine Zähne in das Fleisch des Menschen, dem keine Zeit mehr blieb, Angst zu empfinden. „Dimitri blieb nur noch eines: in das Antlitz des Göttlichen bis in alle Ewigkeit zu schauen, und in seinem Blut und in jeder Zelle seines Körpers die wahre Ordnung der Natur zu spüren.“
In dieser bildgewaltigen, atemlos machenden Sprache peitscht Polly Clark den Leser durch das Schicksal verschiederner Protagonisten, die alle in irgendeiner Weise der Faszination „Tiger“ erliegen
.
Teil eins: Frieda
Frieda ist mit Leib und Seele Tierforscherin. Eines Tages wird in einem englischen Zoo eine Tigerin erwartet, die dem deprimierten Zootiger Lust auf Sex machen und für Nachkommen sorgen soll. Als Betreuerin wird Frieda eingesetzt. Sie hat noch keine Erfahrung mit der Spezies Tiger, beobachtet die durch Verwundungen und Transport gereizte Tigerin fast rund um die Uhr. Wagt sich ungeschützt in den Käfig, weil sie glaubt, das Vertrauen des Tieres gewonnen zu haben, und wird von der Tigerin angefallen. Schwer verwundet kann Fieda noch einen Betäubungsschuss setzen, bevor sie ohnmächtig wird. Frieda hat sich, genau so wie der Fallensteller Dimitri, in einen Kampf mit der ungezähmten Natur eingelassen und verloren. Zwei Warnungen, die die Erzählerin dem weiteren Verlauf ihres „Romans“ voranstellt.
Teil zwei: Tomas
Schauplatzwechsel: Im äußersten Osten Russlands leiten Vater Iwan und Sohn Tomas ein etwas herabgekommenes Reservat, das den wenigen noch lebenden Tigern in der Taiga Schutz und Freiraum sichern soll. Sie kämpfen gegen die Macht der Geldhaie, die auch die letzten Winkel der unberührten Natur vermarkten wollen.Eines Tages bricht Tomas in den von Menschen noch nie betretenen Wald auf, um mit Kamerafallen Bilder von der „Gräfin“, wie sie die dort lebende Tigerin nennen, zu bekommen. Was er aus den Spuren lesen kann, ist ein wilder Lebenskampf zwischen der Tigerin und einem Bär. Und dann entdeckt er auch Spuren einer Frau.. Er entdeckt ein Drama: Vor einer Hütte liegt die Tigerin, unter ihr begraben die Frau. Beide tot. Daneben ein Mädchen. Sina wird sie heißen und er wird sie und das Tigerjunge der Gräfin ins Reservat mitnehmen
.
Teil drei: Edit
Edit stammt von den Udehe, den letzten Ureinwohnern der Taiga. Sie lebt mit dem Russen Waleri in einem Dorf in der Taiga. Als dieser eines Tages eine Tigerin im Käfig gefangen ins Dorf bringt, verlässt ihn Edit. Tiger sind für die Udehe heilige Wesen. Sie nimmt ihre dreijährige Tochter Sina mit und lebt mit ihr in der Tiefe des dichten Waldes, lehrt sie alles, was zum Überleben wichtig ist. Beide überstehen in dieser wilden, unberührten Natur Eiseskälte, Hunger und Hitze. Bis eines Tages die Gräfin sich der Hütte nähert. Edit elingt es, sie tödlich zu treffen, wird aber von der todwunden Tigerin zu Tode gebissen. Hier schließt sich der Kreis der Personen: Tomas wird Sina finden und mitnehmen.
Teil vier: Tiger
Polly Clark scheut sich nicht, die Geschichte der Gräfin zu erzählen und dabei gleichsam hinter die Augen und Ohren, in das Gehirn des Tieres mit der menschlichen Sprache zu dringen. Das gelingt ihr überzeugend gut. Dank ihrer Recherchen für dieses Buch hielt sich Polly Clark monatelang in der russischen Taiga auf den Spuren der Tiger auf. Ohne das Verhalten der Gräfin zu humanisieren, begleitet sie das Tier auf ihren Streifzügen, beschreibt die Geburt der beiden Tigerjungen, die verzweifelte Suche nach Nahrung. Berührend der Tod des einen Jungtieres, ihr wütender Angriff auf die Hütte.
Übergangslos führt die Autorin wieder in das Dorf, wo Sina nach dem Tod ihrer Mutter aufwächst. Und wieder übergangslos landet plötzlich Frieda in diesem Dorf. Mit im Gepäck zwei Tigerjungen aus dem Zoo, die nun zur Auswilderung vorbereitet werden. In dieser allzu gewollten Zusammenführung ihrer Figuren liegt vielleicht das einzige Stolpersteinchen. Aber letzendes genießt der Leser die präszisen und doch hochpoetischen Beschreibungen. Die kleinsten Details bekommen fast mythische Bedeutung. Ein „Roman“, wenn man denn so will. Aber die Bezeichnung tut nichts zur Sache. Wichtig ist Sprachgewalt, mit der die Autorin das Wesen der Tiger erfasst, die letzten unberührten Winkel der Natur schildert. Bilder, die in die Seele eingehen und dort bleiben
http://www.eisele-verlag.de
Ein ähnlich sprachgewaltiges Buch mit ähnlichem Thema sei hier erwähnt:
Nastassja Martin, An das Wilde glauben. Die Anthropologin Nastassja Martin wird in der Taiga von einem Bären in den Kopf gebissen und schwer verletzt. Es ist die Geschichte ihrer Genesung und zugleich eine intensive Begegnung mit ihrem Selbst und der Wildnis. (siehe auch meine Buchbesprechung)