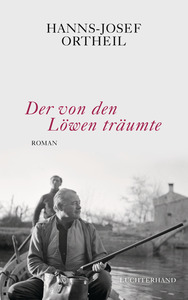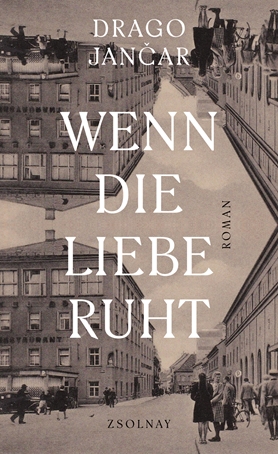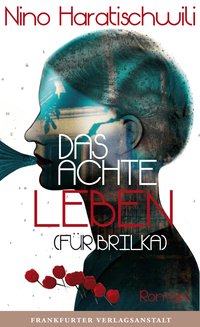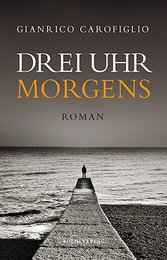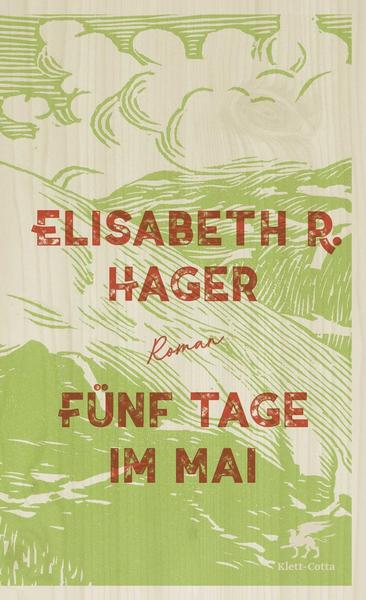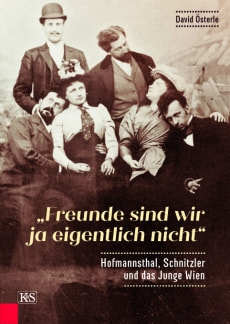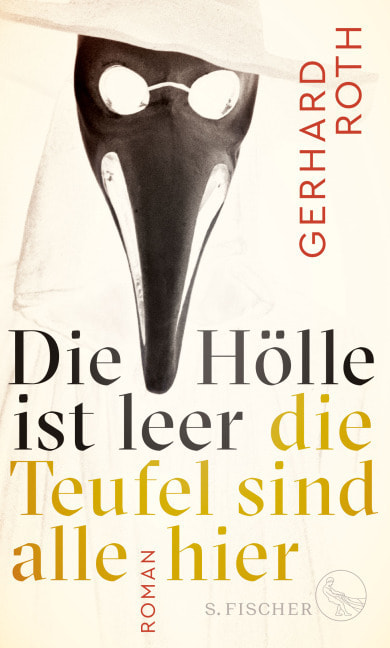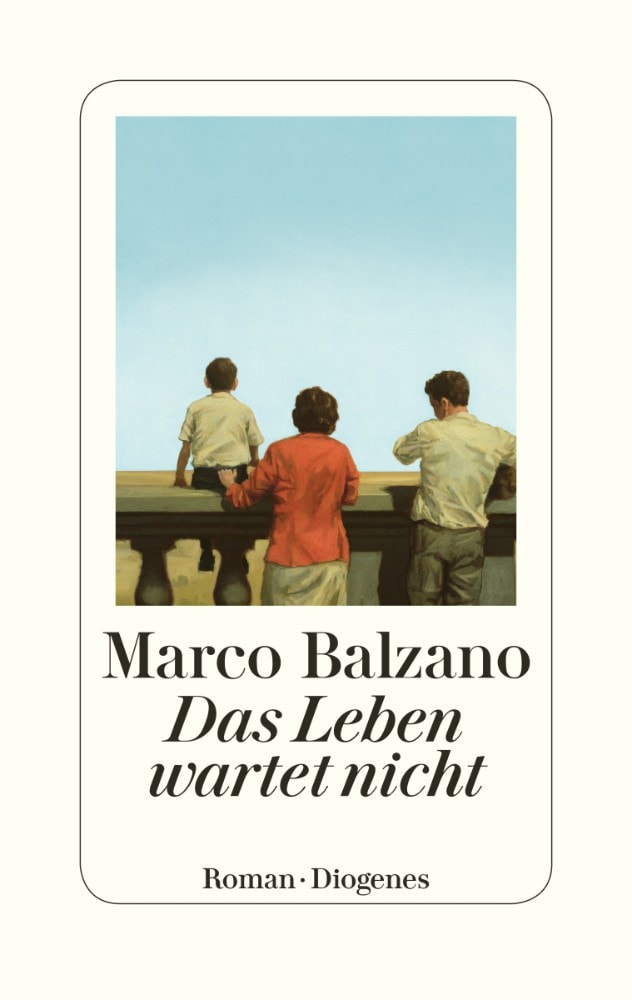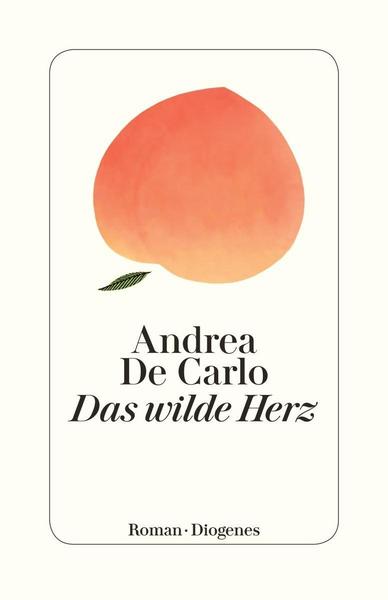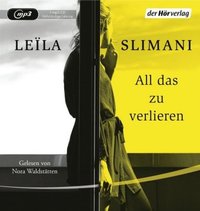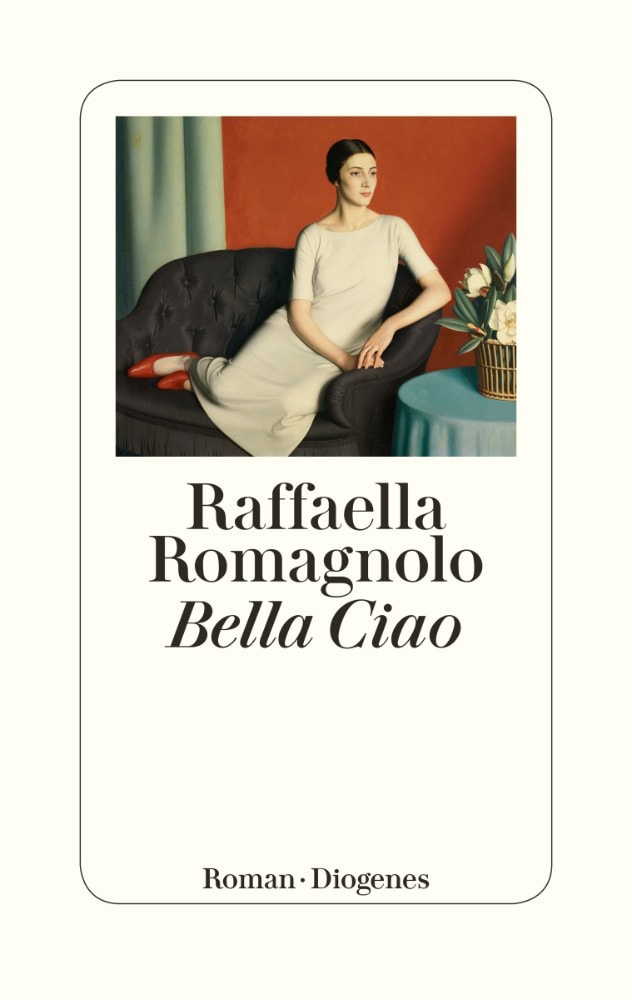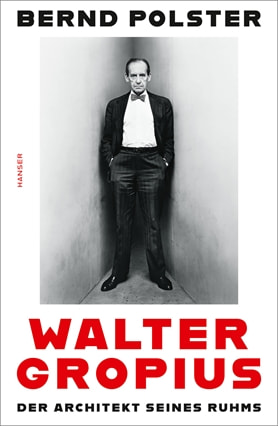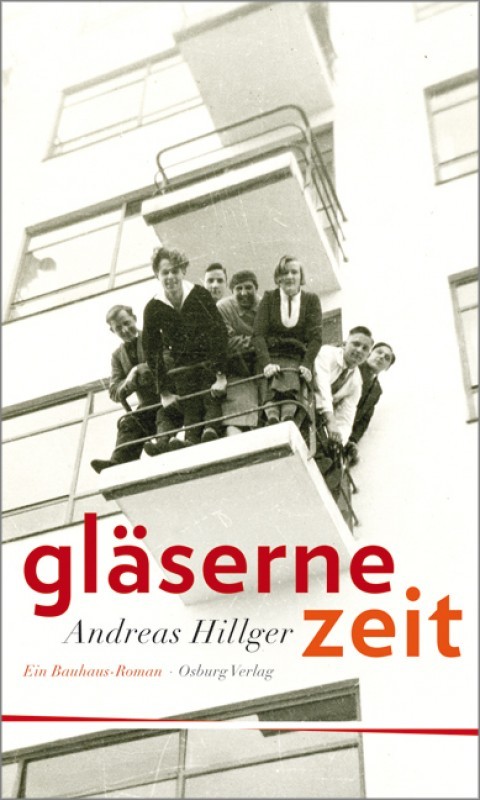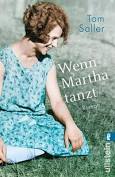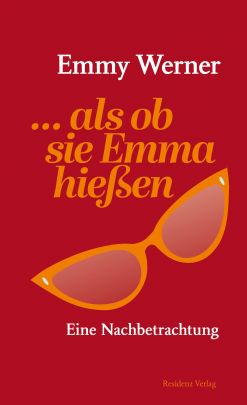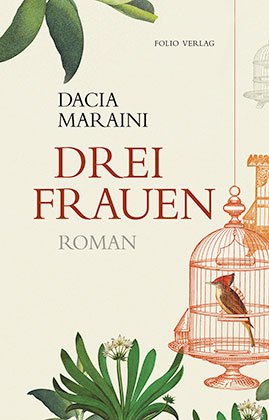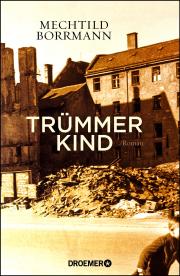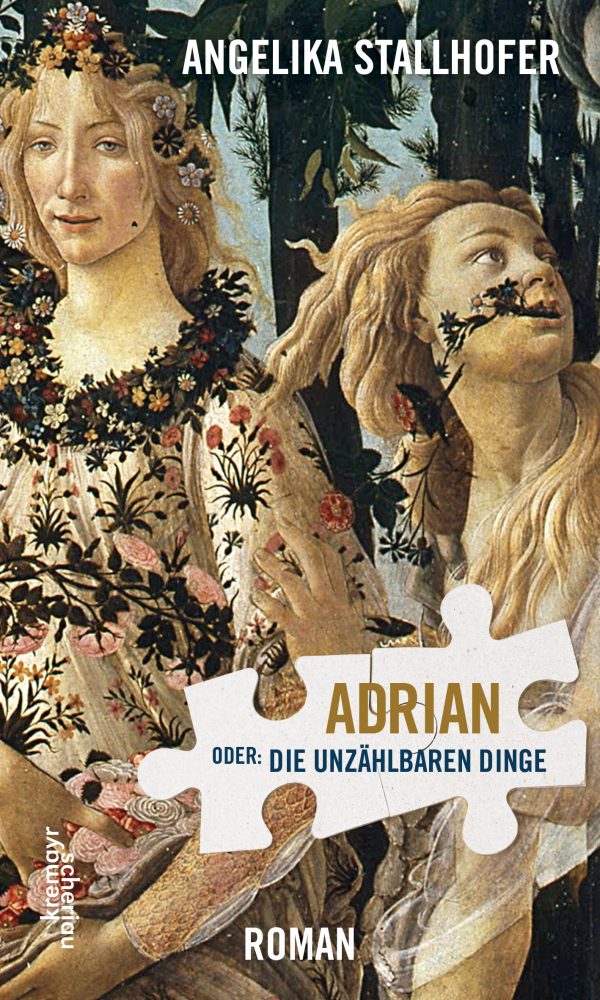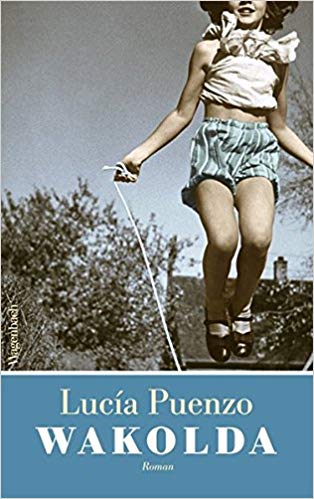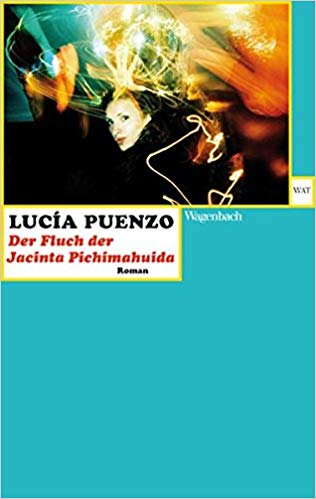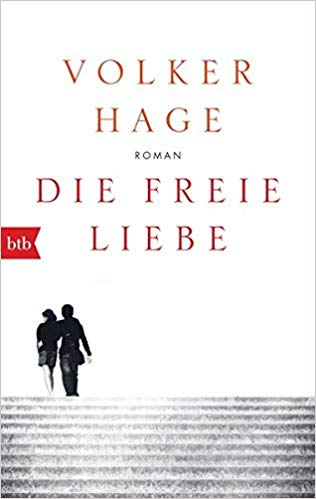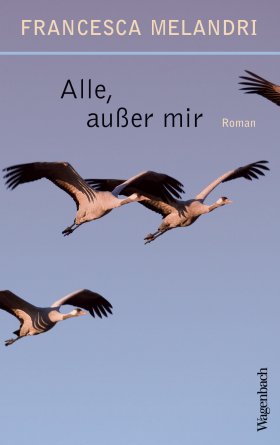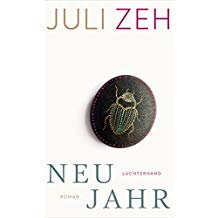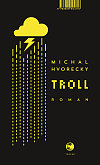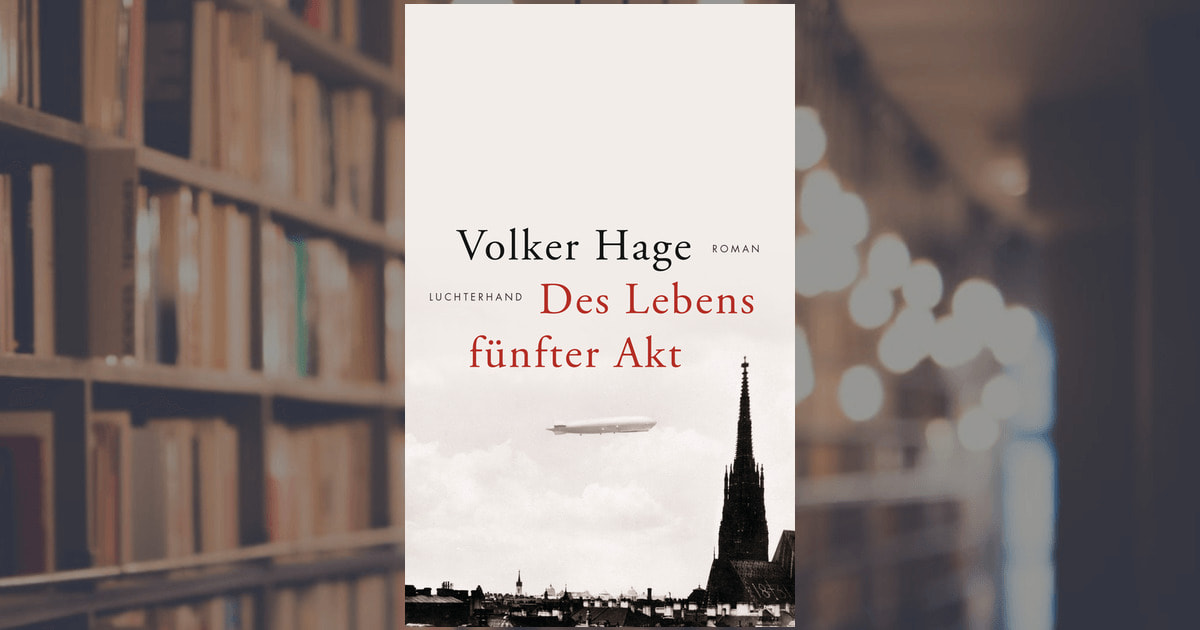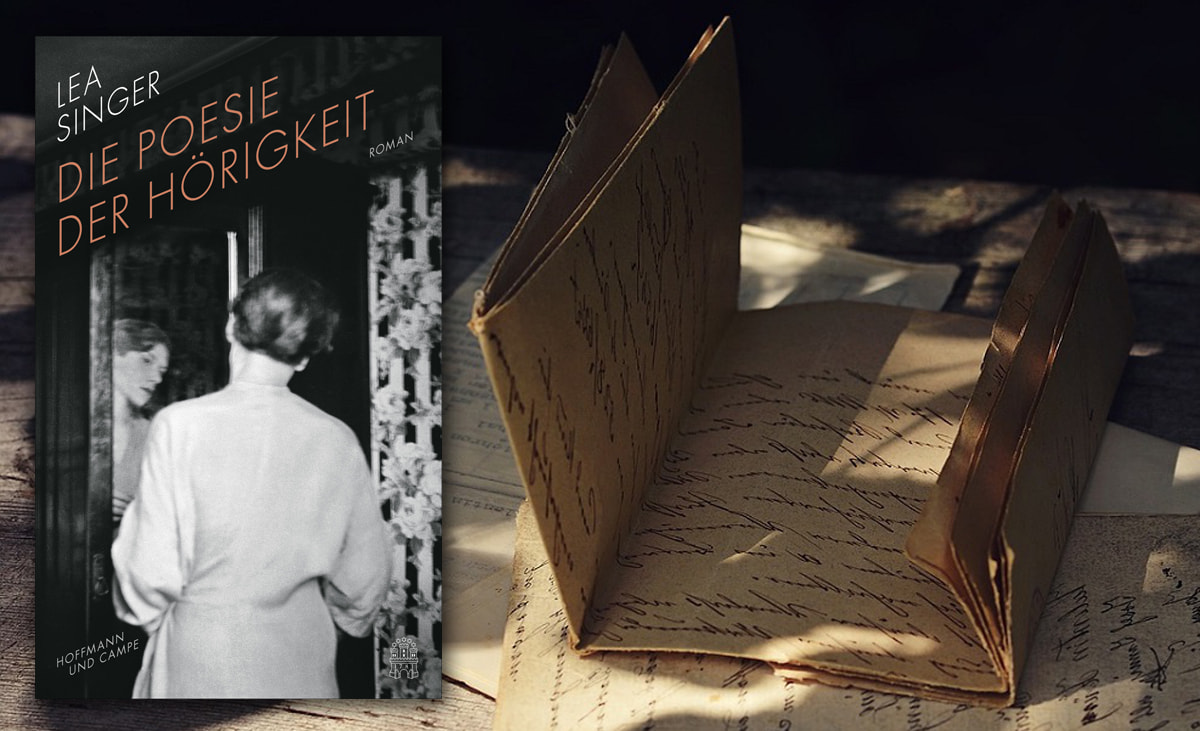In diesem soeben erschienen Band vereint Ortheil alle seine thematischen Vorlieben: Über eine interessante Persönlichkeit schreiben – Hemingway – über einen von ihm geliebten Ort schreiben – Venedig – und über das Schreiben selbst, beziehungsweise über Schreibhemmungen, schreiben.
Literarische Parallelen
Während der Lektüre erlebt der Leser einige Déjà-vu, die zu analysieren ihm spezielles Vergnügen bereiten könnte: Er erinnert sich vielleicht an den Werfelroman über Verdi: Der Komponist kam nach Venedig in einer echten Schaffenskrise, als er glaubte, nie mehr auch nur eine Note komponieren zu können. Dann wird dem Leser unweigerlich Thomas Manns „Tod in Venedig“ einfallen. Als Mann in einer schweren Schaffenskrise steckte, schrieb er sich diese an der Figur von Aschenbach ab. Für Thomas Mann alias Aschenbach wird Venedig zum Todesmythos. Während der Lektüre des Ortheil-Romanes fielen mir weiters die Parallelen zum Film „Il postino“ (Der Postmann) und zum Roman von Antonio Skarmeta „Mit brennender Geduld“, der dem Film zugrunde liegt, ein: Der Dichter Pablo Neruda findet in den Gesprächen mit dem jungen Briefträger einen gelehrigen Schüler, der bald auch Ideengeber wird. So auch in Ortheils Geschichte.
Hemingway, der große Trinker, in der Schaffenskrise
Wir schreiben das Jahr 1948. Ernest Hemingway und seine vierte Ehefrau Mary mieten sich im Hotel Gritti in Venedig ein. Dank des Revolverblatt-Journalisten Sergio Carini weiß bald ganz Venedig, wo und mit wem sich der große Schriftsteller, Kriegsheld und Großwildjäger herumtreibt. Das aber stört Hem, wie ihn Freunde nennen, nicht besonders. Er streift, mit allen nur möglichen Fremden redend und trinkend, durch die Stadt. Alles ist ihm recht, um von seiner Schreibhemmung abzulenken. Sein letzter Roman liegt schon lange zurück. Von Venedig erhofft er sich neuen Stoff und künstlerische Gestaltungskraft. Mit Paolo Carini, dem Sohn des besagten Journalisten, schließt er Freundschaft und engagiert ihn als „Hermes von Venedig“. Während der langen und gemütlichen Bootsfahrten durch die Kanäle notiert er akribisch alles, was er sieht, auch die banalsten Banalitäten. Dem Autor auf die bekannten und weniger bekannten Orte wie Harry‘ Bar, Torcello oder diverse campi zu folgen, bereitet zwar Vergnügen, ist aber doch durch die Banalität der Beschreibungen ermüdend. Etwas zäh wird die Geschichte, als sich Hemingway in die (real existierende) junge Adelige Adriana Ivancich verliebt. Er ist ein alter, müder Mann, der sich von der Achtzehnjährigen Verjüngung und emotionale Hochs erhofft. Aus den Begegnungen mit dieser infantil wirkenden Schönheit entsteht der Roman „Über den Fluss und in die Wälder“, der von der Kritik mit sehr viel Häme aufgenommen wurde und sicher nicht zu seinen besten Werken zählt. Der junge Fischer Paolo Carini wird zu seinem schärfsten Kritiker, ihn stößt alles, was mit dem Roman zu tun hat, ab. Er fordert von Hemingway einen ehrlichen, tiefgehenden Roman und schlägt ihm vor, von einem alten Fischer zu erzählen, der zum letzten Mal aufs Meer hinaus fährt und den Kampf mit einem Riesenfisch aufnimmt. – „Der alte Mann und das Meer“ wird zu einem der wichtigsten und bleibenden Werke Hemingways und Paolo ist stolz, Geburtshelfer gewesen zu sein.
Stilistische Tricks und Schwächen
Ortheil ist ein Meister der Spiegelfechtereien. Geschickt schiebt er reale Fakten und Fiktionen in- und übereinander. Hemingways Aufenthalte und Trinkorgien in „Harry ‚ s Bar“ sind hinlänglich bekannt. Dass der ermüdende Roman „Über den Fluss und in die Wälder“ tatsächlich auf die Liebe Hemingways zu Adriana Ivancich zurück zu führen ist und bei der Kritik durchfiel, ist historisches Faktum. Auch dass Hemingway die junge Adelige samt Mutter nach Cuba auf seine Finca einlud und seine Frau Mary damit ordentlich brüskierte, ist Faktum und wird von Ortheil als Fiktion in den Roman eingebaut. Mit der Familie Carini, Vater und Sohn, später auch Schwester und Mutter, führt Ortheil erfundene Personen ein und verquickt sie mit dem realen Geschehen. Das ist amüsant, weil sich der Leser stets fragt, was ist Fiktion und was Realität. Auf die Spitze treibt Ortheil das Spiel, wenn er Hemingways bekannte Manie, alles, was er beobachtet, akribisch aufzuzeichnen, im Roman eins zu eins umsetzt. Denn die banalen Details bleiben auch als Ergüsse eines Genies immer noch banal und langweilig. Peinlich wird es, wenn Ortheil vorgibt, den Gesprächen zwischen Hemingway und Adriana zu lauschen. Da wird es mehr als banal, peinlich banal.
Unterm Strich: „Der von den Löwen träumt“ ist ein gefälliger Roman, der vielerlei Leserinteressen bedient: Allen voran die der Liebhaber Venedigs, die dem Autor begeistert an bekannte Orte folgen. Auch alle Fans von Romanbiografien werden an dem Buch ihr Vergnügen haben. Immer vorausgesetzt, sie haben die Toleranz, die ausufernde Wiedergabe von Beobachtungen und Gesprächen als inhaltlich notwendig zu akzeptieren.