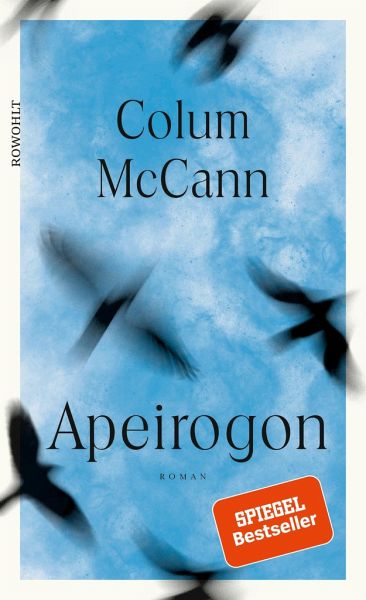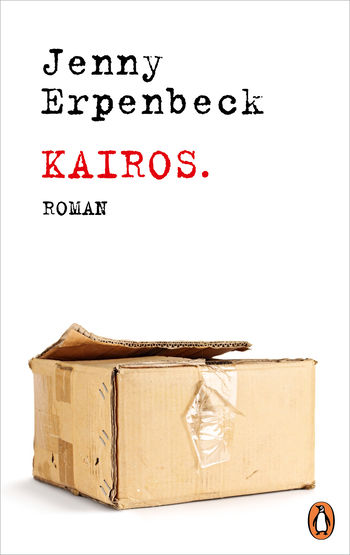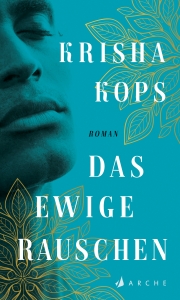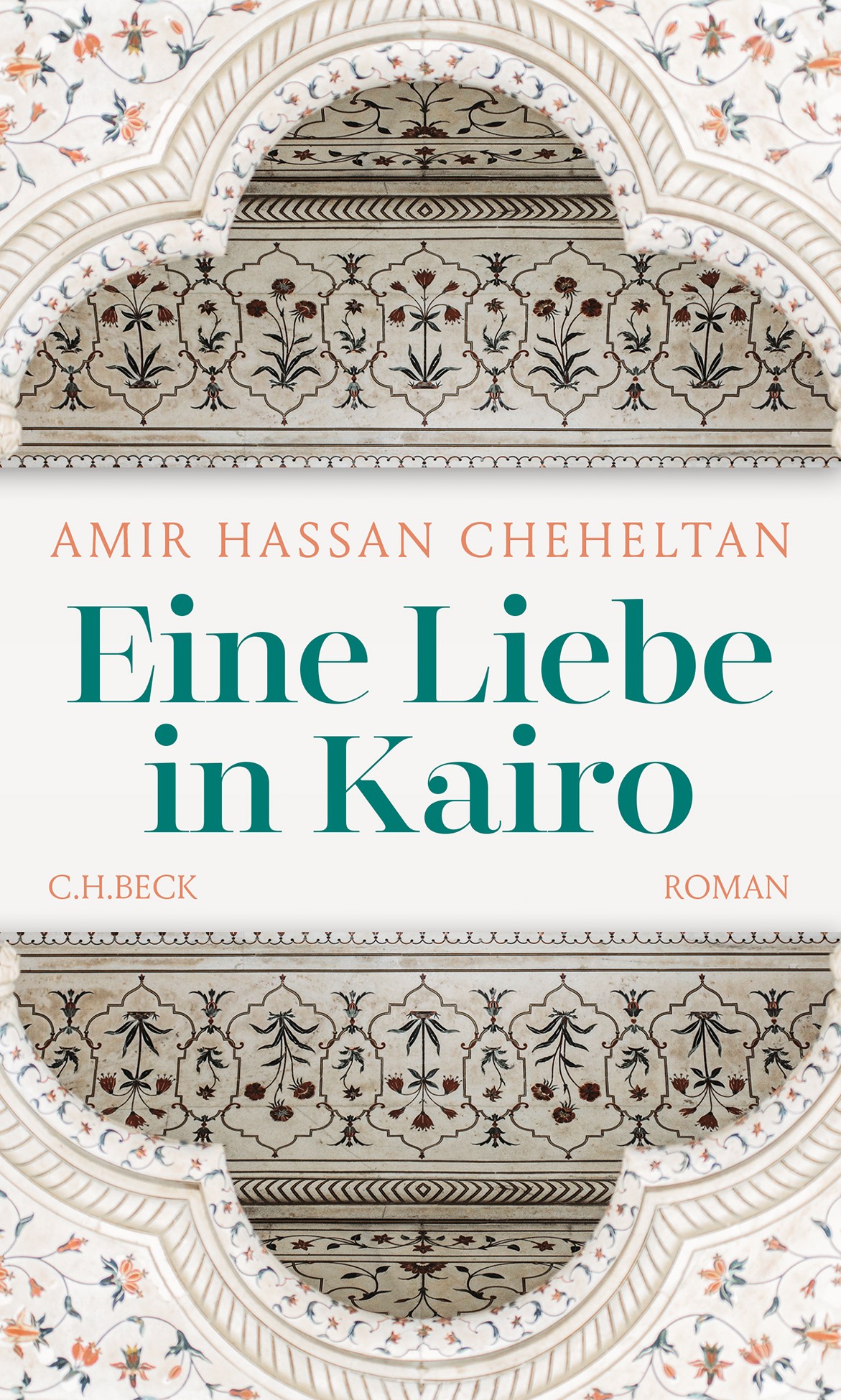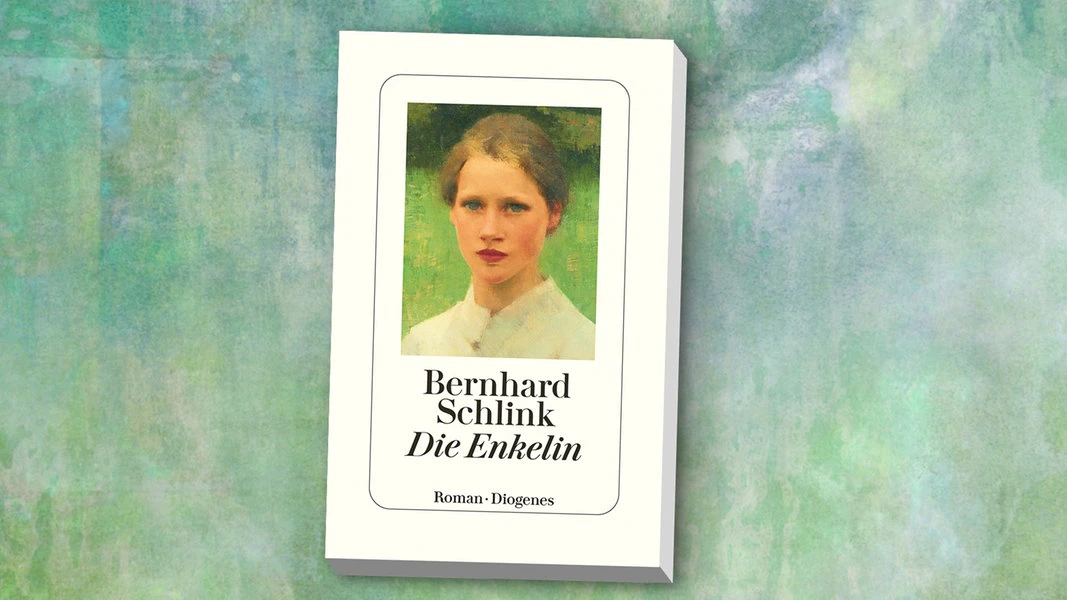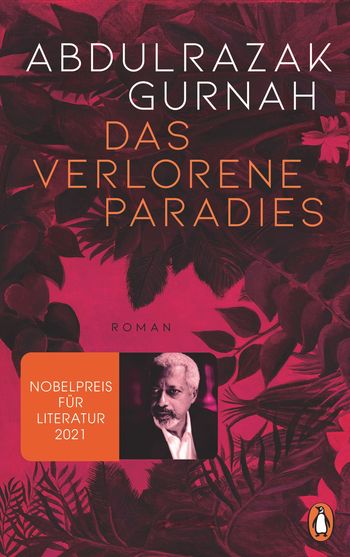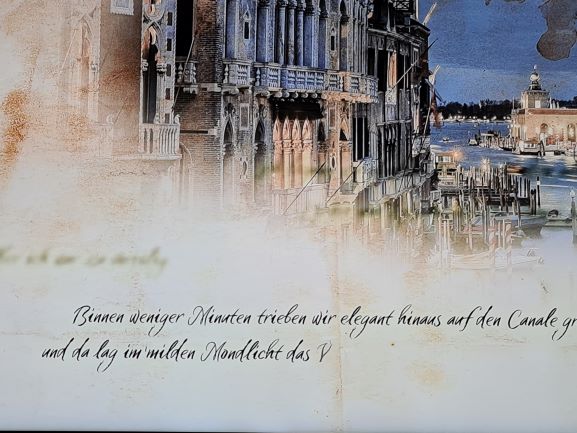Deutsch von Daniel Kehlmann. Regie Janusz Kica. Bühnenbild und Kostüme: Karin Fritz
38 Personen, die fast alle irgendwie miteinander verwandt sind, in einem Stück verstehbar und unterscheidbar auf die Bühne zu bringen, das ist eine Herkulesaufgabe! Die Janusz Kica manchmal bravourös meistert, in manchen Szenen jedoch scheitert. Gleich in der ersten Szene wurlt es auf der Bühne, alles rennt und redet durcheinander. Whos ist who fragt der Zuschauer. Und das bis zum Schluss des öfteren. Ein großartiges Ensemble – man meint fast die ganze Josefstadt steht auf der Bühne – meistert dank einer klugen Personenregie die schwierige Aufgabe, das Schicksal einer jüdischen Familie in Wien von 1889 bis 1955 zu spielen. Zentrum ist Hermann Merz, Textilfabrikant -souverän gespielt von Herbert Föttinger. Er ist Optimist, sieht nicht die deutlichen Zeichen des Judenhasses, der sich in Wien immer mehr ausbreitet. Die Weltausstellung in Paris 1889 verheißt doch einen wirtschaftlichen Aufschwung für alle, meint er. Dagegen argumentiert sein Schwiegersohn Ludwig Jakobowicz (Ulrich Reinthaller). Er weiß, ahnt, dass es nicht besser, nur schlimmer werden wird. Im ersten Akt kommt alles zur Sprache, was eifrige Besucher des Theaters auch schon in dem Stück „Der Weg ins Freie“ gehört haben: Die Frage nach einem Judenstaat, konvertierte Juden – sind es trotzdem Juden -, Mischehe und Anfeindungen an Universitäten etc. So mancher Zuseher mag daher des öfteren ein déjà-vu-Erlebnis – oder besser : ein déjà – entendu ERlebnis -gehabt haben. Die Kürzung so mancher Dialoge wäre nüt:zlich gewesen! Denn dreieinhalb Stunden sind zu lang. Die Geschichte wird weitererzählt: Der finanzielle Zusamenbruch der Firma während und nach dem 1. Weltkrieg. Ein letztes Auffflammen und Momente der Freude während des Festes der Beschneidung. Die Zeichen des nahen Faschismus wollen nicht wahrgenommen werden. Und dann der Zusammenbruch: Die Familie muss in einem Zimmer zusammengepfercht leben, ohne Heizung und Strom! Der packende Höhepunkt des Stückes ist der Auftritt von Joseph Lorenz als „Zivilist“, der die Familie für die Verschickung in die Leopoldastadt und von dort in die Lager auf eine Liste setzt. Diese Szene lehrt den Zuseher das Gruseln – obwohl schon in vielen Filmen gesehen, in vielen Büchern gelesen -aber so kalt und hautnah herzlos wie Lorenz den Mann spielt, da bleibt einem die Luft weg! Die Geschichte endet um 1955, in der Rosa (Sona MacDonald) als eine der wenigen Überlebenden, lakonisch die Namen der in Aussschwitz ermordeten Familienmitglieder aufzählt. Einige, so erfährt man, haben Selbstmord begangen.
Annerkennender Applaus für die Leistung der Schauspieler und wohl auch für die Stückauswahl.